Weinessig selber machen aus Resten von altem Wein

Es war ein netter Abend mit Freunden, und übrig bleiben – neben der Erinnerung an schöne Gespräche – Reste vom Wein. Die sind eigentlich zu schade zum Wegschütten, aber trinken oder verkochen kann man sie auch nicht alle. Warum daraus nicht einfach mal einen eigenen Essig ansetzen, statt sie wegzuschütten?
Seinen eigenen Weinessig aus Wein anzusetzen, ist nicht schwer und braucht neben Zutaten, die du vielleicht ohnehin schon zu Hause hast, nur ein wenig Zeit für die Reifung. Wie du Weinessig aus Weinresten selber machen kannst, erfährst du in diesem Beitrag.
Weinessig selber machen aus Wein – so geht’s
Damit aus dem Wein Essig werden kann, muss er mit Essigbakterien “geimpft” werden. Für ein schnelles Gelingen eignet sich eine Essigmutter, die man fertig kaufen kann (in Bio- und Kräuterläden sowie Drogerien zu beziehen oder online). 100 Milliliter der flüssigen Essigmutter sind ausreichend für einen Liter Wein (plus einen Liter Wasser) und ersetzen im folgenden Rezept den Apfelessig.
Es geht aber auch ohne Essigmutter: wer es nicht ganz so eilig hat, kann stattdessen naturtrüben Apfelessig zusetzen. Er ist nicht wärmebehandelt (pasteurisiert) und enthält lebende Essigsäurekulturen – erkennbar an den Schlieren, die sich auf dem Boden der Flasche absetzen.
Um deinen eigenen Weinessig anzusetzen, brauchst du:
- 1 Teil Wein (Reste von Rotwein oder Weißwein, aber nicht gemischt)
- 1 Teil Wasser
- 1 Teil naturtrüber, nicht pasteurisierter Apfelessig mit etwa 5 % Säure
Folgende Utensilien werden außerdem benötigt:
- Glasgefäß, das etwa doppelt so viel Volumen hat wie die Menge aller Flüssigkeiten
- Kaffeefilter aus Papier, fest gewebtes Passiertuch oder ein Nussmilchbeutel
- Tuch aus Naturfaser, das die Öffnung des Gefäßes reichlich bedeckt (zum Beispiel ein Stofftaschentuch oder ein Geschirrtuch)
- Gummiring
So wird der Essig angesetzt:
- Das Glasgefäß heiß ausspülen und abtrocknen.
- Wein und Wasser in das Gefäß gießen.
- Den Apfelessig durch die Filtertüte oder den das Filtertuch zum Wein-Wasser-Gemisch geben und mit einem Holzlöffel verrühren.
- Stoffstück über die Öffnung des Gefäßes legen und mit dem Gummiring befestigen.
- Gefäß an einen warmen Ort stellen.
Nun beginnen die enthaltenen Essigsäurebakterien, sich zu vermehren und den Alkohol umzuwandeln, und nach einigen Tagen verändert sich der Geruch. Eventuell werden Schlieren in der Flüssigkeit sichtbar, das sind die Anfänge einer entstehenden Essigmutter (siehe weiter unten).
Nach mehreren Wochen ist der Alkohol fast vollständig in Essigsäure umgewandelt, was am Geruch erkennbar ist. Jetzt kann der Essig abgegossen und weiterverarbeitet werden.
Schnupperprobe: Klebstoffgeruch gehört dazu!
Es lohnt sich, ab und zu an der Flüssigkeit zu schnuppern, um den Fortschritt der Essigvergärung abschätzen zu können. Während der mehrere Wochen dauernden Umwandlung von Alkohol zu Essig riecht der Gäransatz zeitweilig verdächtig nach Klebstoff oder Acetat. Das ist normal und zeigt lediglich, dass die Essiggärung im vollen Gange ist. Wenn der Acetatgeruch vollständig verschwunden ist, weißt du, dass der Essig fertig ist. Dann wird der Essig gefiltert, damit er durch die abgestorbene Essigmutter keinen dumpfen Geruch bekommt.
Den Essig verzehrfertig machen
Wenn der Essigansatz nur noch nach Essig schmeckt, aber nicht mehr nach Alkohol, kannst du ihn auf verschiedene Art weiterverarbeiten:
- Essig aus dem Ansatzglas abgießen und durch eine doppelte Kaffeefiltertüte oder feinmaschigen Stoff filtern.
- Falls der Essig zu sauer schmeckt, schluckweise abgekochtes, wieder abgekühltes Wasser beigeben, bis der Geschmack stimmt.
Ab hier unterscheidet sich die Weiterverarbeitung:
- Für pasteurisierten Essig: Den Essig in einen Topf geben. Für etwa zwei Minuten auf 60 bis 72 °C erhitzen und noch heiß in sterilisierte Flaschen abfüllen. Die Flaschen fest verschließen.
- Für nicht pasteurisierten Essig: Den Essig in sterilisierte Flaschen abfüllen und kühl lagern.
Durch das Pasteurisieren werden alle eventuell noch lebenden Essigsäurebakterien abgetötet. Dadurch wird verhindert, dass mit der Zeit Trübungen entstehen. Aber auch ohne Pasteurisieren ist der Essig sehr lange haltbar.
Jetzt kannst du deinen selbst gemachten Weinessig genießen – zum Beispiel in Salaten, Torshi (sauer eingelegte Gemüsemischung), eingelegten Wassermelonenschalen oder als Grundlage für selbst gemachten Kräuteressig.
Nähere Infos zur Essigherstellung
Damit du weißt, was hinter der Wahl der Gerätschaften steckt und wie Essiggärung grob funktioniert, hier ein paar Antworten auf Fragen, die sich inzwischen vielleicht gestellt haben.
Lässt sich auch geschwefelter Wein für Essig verwenden? Ja!
Oft wird davor gewarnt, dass die Essigvergärung bei geschwefeltem Wein nicht funktioniere, weil der Schwefel die Entstehung von Essigbakterien verhindere. Das muss jedoch nicht immer der Fall sein: In unseren Versuchen hat auch der Gäransatz mit geschwefeltem Wein eine Essigmutter ausgebildet. Wer aber ganz sicher gehen will, belüftet den geschwefelten Wein, um die Schwefelverbindungen zu entfernen: Den Wein am besten in einen Mixer gießen und mehrmals ausgiebig mixen, sodass viel Sauerstoff in die Flüssigkeit gewirbelt wird.
Warum den Wein mit Wasser mischen?
Essigsäurebakterien setzen Alkohol 1:1 in Essigsäure um. Das bedeutet, dass aus 12-prozentigem Alkohol 12-prozentiger Essig wird. Das ist für den normalen Küchengebrauch zu stark, denn unser Gaumen ist an Essigsäurekonzentrationen um fünf bis sieben Prozent gewöhnt. Deshalb ist es sinnvoll, den Wein eins zu eins zu verdünnen, bevor man ihn mit Essig oder mit einer Essigmutter impft.
Wie viel Apfelessig gehört in den Ansatz?
Je mehr Apfelessig dem Ansatz gleich zu Beginn zugegeben wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gärung gelingt. Denn ein hoher Säuregehalt von Anfang an verhindert das Wachstum von Hefen (zum Beispiel Kahmhefe, die wie eine weiße Schimmelschicht auf der Gärflüssigkeit schwimmt). Außerdem stoppt er eine eventuell noch existierende alkoholische Gärung.
Wenn du sehr viel Wein zu Weinessig vergären möchtest, dann verwende am besten eine Essigmutter zum Impfen, weil sonst sehr viel Apfelessig nötig wäre (mindestens Verhältnis 1:1:1 aus Wein, Wasser und Apfelessig). Bei kleinen Mengen Wein und um sicherzugehen, dass der Ansatz gelingt, kannst du auch bis zur vierfachen Menge Apfelessig verwenden (Verhältnis 1:1:4 aus Wein, Wasser und Apfelessig).
Welches Gefäß eignet sich am besten für die Essiggärung?
Im Grunde eignet sich jedes einigermaßen weite Gefäß aus Glas oder Kunststoff, das sich mit einem Stück Stoff und einem Gummiband verschließen lässt. Ideal ist es, wenn der Gäransatz möglichst viel Luft bekommt, denn Essigsäurebakterien brauchen Sauerstoff, um Alkohol in Essigsäure umsetzen zu können.
Wenn du einen Weinballon hast und diesen bis etwa zur Hälfte füllst, ist das dem schnellen Gärprozess zuträglich. Aus Platzgründen in der Wohnung ist aber auch ein weites Schraubglas mit zwei Litern Fassungsvermögen für einen Liter Gäransatz sehr gut geeignet.
Warum das Gefäß weder fest verschließen noch ganz offen lassen?
Mit einem luftdurchlässigen Stück Stoff als Verschluss ist gewährleistet, dass Sauerstoff ins Gefäß gelangt, aber Schimmelsporen draußen bleiben, denn Schimmel macht den Ansatz ungenießbar. Ganz ohne Verschluss hingegen würde der Ansatz Essigfliegen und anderen Insekten anlocken, die den Essig verderben.
Den Gäransatz bei welcher Temperatur lagern?
Essigsäurebakterien arbeiten am besten bei einer Temperatur zwischen 25 und 32 °C; ideal sind 28 °C. Im Sommer hat man diese Temperaturen vielleicht ohnehin in der Wohnung. Im Herbst und Winter ist ein Platz in der Nähe der Heizung empfehlenswert. Auch im Heizungskeller ist der Ansatz sehr gut aufgehoben. Eine Gärtemperatur über 27 Grad verhindert außerdem die Entwicklung von Essigälchen und Kahmhefe bzw. Kahmpilzen (siehe weiter unten).
Was schwimmt da im Glas? Pilze, Tiere und Essigmutter?
Während des Gärprozesses können sich verschiedene Stoffe und sogar Tierchen bilden. Hier erfährst du, ob sie der Essiggärung dienlich sind oder nicht:
- Schwimmt eine weiße, undurchsichtige Schicht auf der Flüssigkeit, dann haben sich Kahmpilze (auch Kahmhefen genannt) gebildet. Kahmhefen sind nicht gefährlich oder ungesund, sie können aber den Geschmack des Essigs negativ beeinflussen. Um den Ansatz zu retten, entferne am besten mit einem sauberen Holzlöffel so viel Kahmhefe wie möglich von der Oberfläche der Flüssigkeit. Ursache kann unter Umständen ein zu geringer Säuregehalt sein.
- Wenn sich eine dicke, milchig-durchsichtige Schicht im oberen Bereich der Flüssigkeit bildet: Herzlichen Glückwunsch zu deiner ersten selbst gezogenen Essigmutter! Eine Essigmutter (eine Kultur mit reichlich Essigsäurebakterien) kann ziemlich dick werden (bis zu einem halben Zentimeter) und irgendwann im Glas nach unten sinken. Das tut der Essiggärung aber keinen Abbruch. Im Gegenteil, du kannst sie später für jeden neuen Essigansatz weiternutzen. Nur wenn die Essigmutter braun wird, solltest du sie entfernen, denn dann sind die Essigsäurebakterien abgestorben und verursachen einen dumpfen Geschmack im Essig.
- Eine dünne, durchsichtige Schicht auf der Flüssigkeit ist ebenfalls eine Essigmutter. Essigmütter müssen nicht immer sehr dick werden. Mit deinem Gäransatz ist alles in Ordnung.
- Wenn in der trüben Flüssigkeit helle Flocken bzw. Schlieren schwimmen, ist ebenfalls alles im grünen Bereich, denn die Flocken sind quasi Mini-Essigmütter.
- Manchmal kommt es vor, dass sich kleine Fadenwürmer entwickeln, die sogenannten Essigälchen. In diesem Fall solltest du den Gäransatz wegschütten – es sei denn, du kennst jemanden mit Aquarium, denn Essigälchen werden auch als Lebendfutter für Fische gezüchtet.
Tipp: Wenn sich sämtliche Schwebstoffe gelegt haben und die Flüssigkeit wieder klar ist, ist das ein Zeichen dafür, dass die Essigsäurebakterien nicht mehr arbeiten und abgestorben sind.
Du hast keinen alten Wein zu Hause, möchtest aber trotzdem einmal spontan einen eigenen Essig ansetzen? Kein Problem, denn Essig lässt sich aus jedem Rest von Trinkalkohol herstellen; wichtig ist nur, dass er dir schmeckt.
Wie du viele weitere gesunde Alternativen zu fertigen Produkten selber machen kannst, erfährst du in unseren Büchern:
Hast du auch schon einmal Essig selber gemacht? Dann freuen wir uns über Tipps und Anregungen in den Kommentaren!
Diese Themen könnten auch interessant sein für dich:
- 13 Tipps: Wirksame Essig-Anwendungen in der Küche
- Apfelessig und anderen Fruchtessig ganz einfach selbst herstellen
- 35 Tricks – Wie Essig zahlreiche teure Drogerieprodukte spielend ersetzt
- Mädesüß und Weidenrinde – natürliche Alternativen zu Aspirin





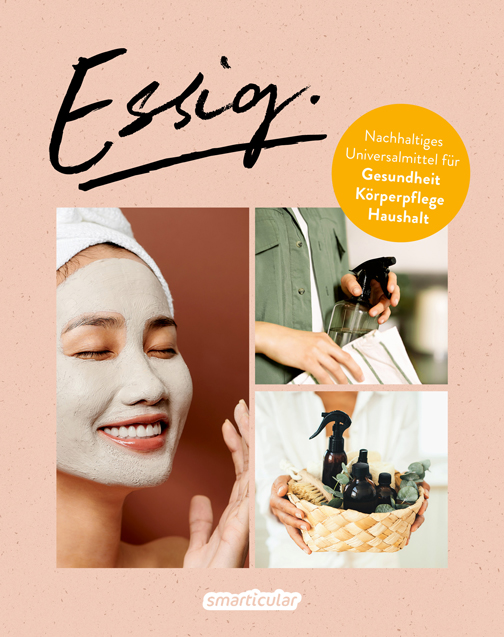




Hallo,
Ich wollte Bieressig herstellen, habe in das Bier (4,5%iges, Kohlensäure war kaum noch drin) meine Essigmutter rein getan (sank runter), abegedeckt. Es bildete sich nach etwa zwei Wochen an der Oberfläche eine Art Schaum, der aber zusammenhing wie ein Belag. Den habe ich entfernt. Nach drei Wochen riecht es nun weder nach Alkohol noch nach Essig noch nach Aceton. Einfach irgendwie undefiniert. Hatte das schon mal jemand?
Liebe Grüße
Hallo Tatjana,
bei dem Schaumartigen hat es sich evtl. um (Kahm-)Hefen gehandelt. Wenn der Ansatz noch nicht unappetitlich riecht, würde ich ihn erstmal stehen lassen. Je nachdem, wie warm er steht, kann das auch noch ein bisschen dauern.
Lieben Gruß
Heike
Hallo Heike,
Ich habe den “Essig” dann in eine Flasche umgefüllt – nicht dicht verschlossen – und in dem Zusammenhang die Essigmutter entfernt. Jetzt steht er weiter bei normaler Zimmertemperatur. An der Oberfläche hatte sich eine neue Essigmutter gebildet (sieht jedenfalls aus wie eine), obwohl sich der Geruch nicht verändert hat. Beim Bewegen der Flasche ist die neue Essigmutter gesunken und “steht” jetzt in der Flüssigkeit. Ich werde das Ganze weiter stehen lassen und beobachten…
Eigentlich dachte ich ja, wenn man eine Essigmutter benutzt, geht die Essigproduktion schneller als ohne. Dieser Ansatz steht aber jetzt schon deutlich länger als alle Ansätze, die ich vorher ohne Essigmutter ausprobiert habe. Der einzige Unterschied: Die Flüssigkeit ist Bier, kein Wein oder Met…
Viele Grüße
Kann ich den fertigenessig unabgekocht in einem zuen Gefäß lagern oder gärt der weiter und der Druck in der Flasche nimmt dann zu?
Du musst ihn durchseihen, die Essigmutter neu ansetzen und dann den Essig weiterverarbeiten. Es kann sich in dem durchgeseihten Essig wieder neue Mutter bilden. Das macht aber nix.
Immer auf Hygiene achten und Glas und Werkzeug sterilisieren
Bei meinem letzten Beitrag muss es richtigerweise 3l Glühwein + 1,5 lRotwein und 4,5 l Wasser,heißen
Hallo Kurt,
das klingt gut! Du kannst ab und an mal nachschauen, ob sich nicht doch Schimmel oder Kahmhefe bildet, aber außer Warten hast du derzeit nichts zu tun.
Viel Erfolg!
Heike
Hallo Heike habe heute 3l fertigen Glühwein +1,5 l Rotwein mit der selben Menge gemischt(also 9l insgesamt)und dazu eine bio Rotweinmutter gegeben. Den ganzen Ansatz mit einem Leinentuch verschlossen und einmal ungerührt und lasse ihn jetzt im Heizungskeller stehen. Was muss ich weiter tun ausser warten zb – Kontrolle eventuell noch mal umrühren vielen Dank für deine Unterstützung
Ich hatte es mit Rotwein probiert, dies hat aber scheinbar icht geklappt. Nichts passierte und ist mir dann verschimmelt.
Hallo Frank,
das ist schade! Ja, es kann am Schwefel im Wein liegen, deshalb war das gut, den Wein nochmal “aufzumischen”. Allerdings spare ich mir das inzwischen, weil es bei mir bisher auch immer ohne Aufwirbeln geklappt hat.
Hast du sonst noch irgendwas anders gemacht als sonst? Bisher haben deine Essig-Kreationen ja immer super funktioniert, oder?
Lieben Gruß
Heike
Hallo. Nein ich habe nichts anderst gemacht. Darum war ich überrascht. Bisher hat immer alles geklappt. Das ist komisch.
Hallo Frank,
jetzt mal vorsichtshalber nachgefragt: Du packst in den Ansatz aber schon eine fertige Essigmutter rein, oder?
Lieben Gruß
Heike
Bin noch Anfänger, habe einen alten Irdenen Steingut Topf mit weitem Hals und tönernem Deckel und Spundloch +Hahn (Inhalt 15 l) geschenkt bekommen. stammt aus einer Essigfabrik
Kann ich den verwenden ?
Habe noch 5l fertigen Glühwein in Flaschen. Kann ich den verwenden und wenn ja, was muss ich machen
Hallo Kurt,
oh, das klingt spannend! Ja, den Glühwein kannst du auch verwenden. Mische ihn wie in der Anleitung beschrieben mit Wasser und naturtrübem Apfelessig, und decke ihn in deinem schicken Gefäß mit einem luftdurchlässigen Tuch ab. Dann heißt es warten.
Schneller geht’s, wenn du dir eine Essigmutter besorgst oder eine selber züchtest: https://www.smarticular.net/essigmutter-herstellen-fuer-eigenen-essigansatz/ Lieben Gruß
Heike
Bei Wein dauert es wohl länger bis man da eine neu bildeten Essigmutter sieht. Mein Ansatz steht jetzt eine Woche und ich habe noch keine Schicht oben. Beim Bier und so ging das deutlich schneller. Ist das normal ?
Hallo Frank,
ja, das ist völlig normal, alles gut! :)
Lieben Gruß
Heike
Ja ich habe gelesen besser ist es wenn man den Wein mit einem Mixer bearbeitet wegen dem lösen des Schwefel. Gut das habe ich jetzt nachgeholt. Mutter raus, stabmixer und mal was gewirbelt. Dann Mutter wieder rein. Mal sehen. Hoffe das bringt was?!
Hi ich bin’s nochmal, vielen Dank für die Antwort!
Mein Ansatz ist mittlerweile knapp 3 Wochen alt und es hatten sich so weißliche „Ablagerungen“ am Rand gebildet und auf einem sogar eine milchig, weißlich schimmernde Schicht. Ich hatte Angst und habe die Gläser auf die Heizung gestellt. Nun sieht es aus als wär alles zu Boden zum Rotwein Absatz gesunken. Wurde es zu warm? Ich hatte die Heizung auf Stufe 2 und denke die ganze Mischung hatte so gefühlt 35-40 grad :/ es roch auch schon nach Kleber aber im Moment eher so fruchtig Glühwein mäßig :0
Ganz liebe Grüße und einen schönen 2ten Advent :)
Dann ist alles richtig,glaub ich
Hallo Ihr Lieben, habe Birnen angesetzt und nun dürfen sie abgeseiht werden, und zur Essigmutter werden. Bisher habe ich die Früchte auf den Kompost, das erscheint mir aber zu schade. Hat jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank:-*
Hallo zusammen
Ich möchte für einen Adventskalender eine Essigmutter verpacken. Ich brauche 24 Gläser davon (24 Frauen mir je 23 Geschenken). Soll ich in jedem Glas eine Mutter züchten mit Bio-Apfelessig, Wein und Wasser? 2 habe ich schon, kann ich diese auch zerschneiden und kleine Teile zu der Mischung geben damit es schneller geht? und wie viele Tage darf ich sie dann vor dem Verschenken verschlossen lagern? Danke sehr für die Antwort
Hallo Nicole,
was für eine tolle Idee!
Ich denke, es ist einfacher, wenn du kurz vor der Übergabe eine vorhandene Essigmutter (oder mehrere) zerschneidest und die Stücke zusammen mit ein wenig Ansatzflüssigkeit (also z.B. Wasser und Wein 1:1 verdünnt, es braucht keinen weiteren Apfelessig) in die Gläser gibst.
Essigmütter sind, was den Sauerstoff angeht, oft robuster als man zunächst so denkt. Eine Woche ohne frische Luft halten sie schon gut aus.
Lieben Gruß
Heike
Danke liebe Heike
Unterdessen habe ich 23 Gläser neu angesetzt. habe ich richtig verstanden, dass ich diese nicht zusätzlich ab und zu mit Wein füttern muss, damit die Mutter entsteht? Einfach stehen lassen? Danke nochmals.
Hallo Nicole,
bis Weihnachten reicht es, wenn du ihnen einmal ein verdünntes Schlückchen Alkohol gönnst. Schon alleine, damit nicht die ganze Flüssigkeit bis dahin verdunstet.
Lieben Gruß
Heike
Was für ein tolles Rezept! Danke erst einmal dafür.
Ich hätte jetzt noch ein paar Fragen dazu:
1.) Ich habe einen offenen Wein (abgefüllt aus dem Urlaub mitgebracht bekommen) der auch noch gut schmeckt aber etwas anders riecht als frisch. Kann ich damit meinen Weißweinessig ansetzen?
2.) Wenn ich kein Gefäß habe, das genau passt dass die Hälfte voll und die Hälfte leer ist, soll dann lieber mehr leer oder mehr voll sein?
3.) Man kann eine Essigmutter ja immer wieder verwenden um Essig zu machen. Wie funktioniert das? Vor allem wie bewahre ich diese auf? Oder muss man dazu ununterbrochen hintereinander Essig machen, sodass sie immer beschäftigt ist?
Danke für eine Antwort, dann könnte ich direkt loslegen mit meiner ersten Essigproduktion *.*
Geplant ist daraus dann noch Kräuteressig herzustellen, der dann an Weihnachten verschenkt wird (unter anderem an denjenigen, der mir den leckeren Wein aus dem Urlaub mitgebracht hat).
LG Anna
Hallo Anna,
hier ein paar Antworten:
1) Wenn der Wein noch gut ist, kannst du ihn für den Essigansatz nehmen, ja.
2) Wenn das Gefäß eine große Öffnung hat, dann kann es ruhig eher voll sein. Bei Gefäßen mit kleinen Öffnungen (z.B. Flaschen oder Weinballons) ist es besser, wenn mehr Platz und damit mehr Sauerstoff vorhanden ist.
3) Wenn der Essig fertig ist, gießt du ihn ja ab. Lass dann einfach die Essigmutter im Gefäß und gib ihr ab und an ein wenig verdünnten Alkohol, damit sie was zu Futtern hat. Wenn du wieder Essig machen willst, kannst du das Gefäß dann wieder höher füllen.
Will heißen: Die Essigmutter braucht Alkohol und Sauerstoff, um zu überleben; dafür braucht sie aber nicht literweise Flüssigkeit. Nur vertrocknen sollte sie halt nicht und wenn sie braune Stellen bekommt, ist das ein Zeichen dafür, dass nicht mehr genug Alkohol vorhanden ist. Dann einfach wieder eine kleine Menge verdünnten Alkohol dazu gießen, bis sie reichlich bedeckt ist.
4) Das mit dem Kräuteressig ist eine super Idee, da wünsche ich dir viel Spaß beim Experimentieren! Unseren Beitrag dazu kennst du? https://www.smarticular.net/kraeuteressig-selbst-ansetzen-tipps-und-rezepte/
Lieben Gruß
Heike
Hallo Heike
ich würde gerne eine grosse Menge Wein zu Essig machen. Die Essigmutter ist bereits am Entstehehen.
Was kannst du mir für Tipps geben, was die Menge anbelangt?
Danke im voraus.
Tom
Hallo Tom,
generell ist bei großen Mengen nicht mehr zu beachten als bei kleinen. Hauptsache bleibt, dass der Ansatz vor Schimmel geschützt und die Sauerstoffzufuhr gewährleistet ist, damit der Alkohol in Essig umgewandelt werden kann.
Wenn du beispielsweise einen Weinballon mit enger Öffnung zur Verfügung hast, fülle ihn nur bis zur Hälfte mit verdünntem Alkohol und der Essigmutter, damit die Oberfläche, an die Sauerstoff gelangt, möglichst groß ist. Alles andere bleibt gleich. Mit einer ganz frischen Essigmutter kann es ein bisschen länger dauern, bis der Essig fertig ist, aber beim nächsten Ansatz geht’s dann schon schneller, weil die Essigmutter größer sein wird.
Lieben Gruß
Heike
Frage mich gerade, ob dieser Aufwand überhaupt nötig ist. Habe nämlich vor längerer Zeit im Keller mal eine fast leere Flasche Wein gefunden, die wurde da nur kurz abgestellt und dann vergessen. Sie stand, der Korken war also nicht mehr feucht und daher luftdurchlässig. Und siehe da: es war Essig draus geworden. Steht da nun immer noch und ich frage mich, ob man die nicht auch so verwenden kann.
Verdünnen? Da ich auch bei normalem Essig immer mit Essig Essenz arbeite, nehme ich eh nur wenig, insofern denke ich, komme ich mit einem unverdünnten Weinessig auch klar. Bzw. würde ich ihn erst bei der Nutzung verdünnen.
Hallo Uta,
das kann passieren, dass sich der Wein auch so in Essig verwandelt, muss aber nicht; es kommt ein bisschen auf die Umgebung an, sonst können sich auch Schimmel, Kahmhefen, Essigälchen und sonstiges bilden, was man nicht im Essig haben will. Aber schön, dass das bei dir auch so geklappt hat!
Verdünnt wird der Essig für den Verzehr, weil 12 Prozent oder mehr Essigsäurekonzentration für die meisten Gaumen ungewohnt oder schlicht zu sauer ist. Ob du den Essig gleich verdünnst oder je nach Geschmack, bleibt deine Entscheidung.
Lieben Gruß
Heike
Hallo Heike,
kann ich mit meinen eigenen Essig auch Gemüse einwecken, wie saure Gurken? Oder gibt es da etwas zu beachten?
Liebe Grüße Lisa
Liebe Lisa,
na klar kannst du damit auch Gemüse einwecken; klingt superlecker! :)
Das ist ja ganz normaler Essig, nur eben selbst gemacht. Den kannst du genauso verwenden wie gekauften. (Ich habe z.B. aus meinem selbst gemachten Weißweinessig neulich Himbeeressig gemacht, ist auch prima gelungen.)
Viel Spaß noch und liebe Grüße
Heike
Liebe Heike,
danke für die schnelle Antwort ☺️
Hallo, ich habe verschiedene Sorten Essig gemacht. Apfel, Rotwein und Granatapfel (an Tomate Essig habe ich mich auch versucht, ist mir leider nicht gelungen, werde es nächstes Jahr nochmal versuchen). Bei den letzteren 2 ohne zusatz von Wasser, also 100 % Saft. Nur bei Apfel habe ich Wasser verwendet. Essigmutter hat sich auch bei allen wunderbar gebildet, den ich hin und wieder entfernt habe damit die Bakterien wenn sie absterben nicht den Essig vederben. Apfel ist prima geworden nur bei Rotwein und Granatapfel Essig ist mit der Zeit ein dumpfer Geruch entstanden, anfänglich hat es super nach Essig gerochen. Und der Geschmack ist auch etwas dumpf, erinnert nicht unbedingt an Essig. Was ist da schief gegangen kann mir da jemand einen Tipp geben wie ich das retten kann?
Also zum Tomatenessig….
Ich habe die Tomaten geschnitten und in ein großes Glas gegeben. Darauf kam Tafelmesser mit mediterranen Kräutern, aufkochen und drüber geben. Das zieht jetzt gesamt 4-6 Wochen. Dann durchseihen und gut isses. Schaut bisher super aus 👍
Tafelessig natürlich 😁
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich Tomatenessig herstelle? Habe zwar im Internet etwas gefunden, aber das weicht ziemlich von der üblichen Herstellung von Essig mit zB Essigmutter ab
Danke an alle
Hallo Richarda, wir haben das noch nicht probiert. Ich bin gespannt, ob jemand Erfahrungen damit hat.
Lieben Gruß
Heike
Hallole!
Kurze Frage zu Weinessig: geht statt apfellessig auch verd. Tafelessig/Essigessenz?
Hallo Schmusie,
da in beiden Essigsorten nicht mehr viel lebt, wird das nicht funktionieren. Für den Ansatz braucht es schon ein paar lebendige Essigsäurebakterien, deshalb nicht-pasteurisierter, naturtrüber Apfelessig. Es sei denn, du hast eine Essigmutter, dann brauchst du gar keinen anderen Essig.
Lieben Gruß
Heike
Hallo,
kann ich auch erstmal nur Wein mit einer Essigmutter “impfen” und erst mit abgekochten Wasser verdünnen wenn der Essig fertig ist? Ich brauche eine größere Menge und so wäre das einfacher bis er abgefüllt wird.
LG
Hallo latBaerchen,
solange der Wein nicht mehr als zehn Prozent Alkohol hat, sollte das funktionieren. Einen Rechner, der dir hilft, das richtige Verhältnis von Alkohol und Wasser herauszufinden, findest du auf dieser Seite ganz unten:
Lieben Gruß
Heike
Hallo latbaerchen,
wie in meiner anderen mail geschrieben, habe ich Wein immer zum fertigen Essig mit Mutter dazugekippt und dann den Essig verdünnt, wie Du ja auch schon geschrieben hast. Und in 5L Flaschen geht das wunderbar.
Liebe grüsse
Dino
<c carpe diem
Danke ,Heike
ich habe mehrere Ansätze für Rotweinessig,aber auch Apfelessig hergestellt.Zu meiner grossen Freude hat es geklappt,dass sich Essigmutter gebildet hat,mehrere Schichten, flach, gewellt.Nun sind auf der Essigmutter in zwei der Gefässe weissliche Knubbel zu sehen.Ist das normal?Als wären sie Teil der Essigmutter…mehrere Wochen stehen die Gefässe warm
Hallo Ingrid-Marie,
meine Essigmütter haben auch immer mal Hubbel und Beulen; solange du nicht den Eindruck hast, dass sich der Geruch negativ verändert, ist alles in Ordnung.
Lieben Gruß und viel Spaß noch
Heike
Hallo, ich bin leider erst jetzt auf das Rezept gestoßen und hätte ein, zwei fragen :)
Wieso filtert man den Apfelessig? Bleiben die lebenden Kulturen dann nicht im Filter zurück?
Und kann man auch 15%igen Wein nehmen und dann einfach ein bisschen mehr Wasser? Ganz liebe Grüße und vielen Dank!
Hallo Mona,
mit der Filterung werden nur die groben Stückchen und Schlieren entfernt; es bleiben genügend Essigbakterien erhalten.
Ja, du kannst den Wein auch unverdünnt ansetzen und erst später den Essig mit Wasser verdünnen.
Lieben Gruß
Heike
Hallo :)
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Auf meinen Gemischen (Bier und naturtrüber Essig) hat sich oben so eine Schicht gemeldet :/ in allen Gefäßen. Ist das Schimmel? Ich kann es echt nicht erkennen.
Danke♡
20200124_185214
Hallo Eva,
so eine Ferndiagnose ist ein bisschen schwierig. Wie riecht die Flüssigkeit denn? Wenn sie sauer riecht, ist alles ok, wenn nicht, könnte es Schimmel sein. Und welches Bier hast du denn genommen?
Lieben Gruß
Heike
Danke, Heike :)
Also es riecht auf jeden Fall noch sauer. Die Schicht oben ist glibberig und hängt an einem Stück zusammen. Inzwischen ist die Scheibe auch untergegangen. Das Bier war “Landbier” bzw. “Rotbier”, oder so :D stand nach ner WG-Party geöffnet, aber nicht angerührt rum🙈
Hallo Eva,
na das klingt doch sehr nach einer Essigmutter, super!
Lieben Gruß
Heike
Sorry, ich wollte nichts auf Ursula Schuster antworten, sondern etwas zu den allgemeinen Informationen zur Essigherstellung schreiben. Ich weiß nichts, warum das jetzt dort eingehängt wurde, wo es steht.
Hallo Heike,
den einen oder anderen Tipp hätte ich noch.
Wenn’s Dich interessiert schreib mir Deine e-mail-Adresse – denn das könnte etwas umfangreicher werden :-)
< Dino
Hallo Dino,
na wenn du sie Stück für Stück hier in die Kommentare füllst, haben wir doch alle was davon. :0)
Schönen Gruß
Heike
Hi evrbody,
Essig selber ist wunderbar, weil der Phantasie keine Grenzen gesetzt sind was dem fertigen Ewig zugesetzt werden kann um ihm ein interessantes Aroma zu geben. Eine solche Kombination habe ich mal ausprobiert :
Schoko- Nuss- Knoblauch Rotweinessig.
Ein Tip noch. Bei (m)einem Weinhändler habe ich um die Reste seiner Degustationsweine
gebeten und bekommen. Die sind ausreichend belüftet. Ein Nebeneffekt, ich konnte mir sortenreine Essige ziehen: von der Scheurebe, Weissherbst, Pinot, Merlot etc etc. Ich habe noch eine Magnum mit Goldwasser-Sekt, d.h. in dem schwimmen Goldplättchen. Da scheint mir dann ein ganz besonderer Essig möglich, zumindest der Aha-Effekt wäre gelungen.
< Dino
Hallo Dino,
das klingt ja sehr spannend! :) Du hast recht, man kann sich mit der Zeit an die interessantesten Kombinationen wagen. Danke für den Tipp mit den Degustationsweinen!
Liebe Grüße
Heike
Hallo, meinen Essig habe ich in 5l Glasballons gemacht und dann stehen lassen, jetzt schon über mehrere Jahre.
Der Prozentsatz des Essigs richtet sich nach dem Alkoholprozentsatz des Weins.
Wenn die erste (kleinere Menge) Essig fertig war, habe ich immer nur noch den gut belüfteten Wein nachgekippt. Dir Luft nimmt dem Wein den Schwefel, der sonst die
Essigbildung stört.
Nach und nach habe ich dann Essig angezeigt und mit z.B. Kräutern versetzt, also einen Essigentzug gemacht /wie Alkoholentzug und dann verdünnt. Heute verdünne ich nach Geschmack und komme weitestgehend dahin einen Essig um 6% zu haben.
Früher habe ich mit Blaulauge den Prozentsatz bestimmt und dann die benötigte Menge an Leitungswasser berechnet/ zugefügt – Braunschweig hat extrem gutes Trinkwasser :-)
liebe grüsse
Dino
< carpe diem
Es ist immer interessant zu lesen, was man alles bei der Essigherstellung beachten sollte. Ich lasse meinen Essig in Einmachgläsern von 1,5 l “werden”, indem ich ein Küchentuch über das Glas lege und eine Nylonsocke drüber spanne (Öffnung nach unten). Klappt prima und alle lästigen Tierchen bleiben draußen!!!
Der Hinweis auf die Kahmpilze irritiert mich. Auf anderen Seiten werden die quasi mit der Essigmutter gleichgesetzt. D.h. die Kahmhaut wäre erwünscht und gerade kein Grund, den Essigansatz zu verwerfen.
Ich habe ganz sicher bei zu niedrigen Temperaturen angesetzt, habe keinen Zucker zugefügt und mir die Apfelreste+ Wasser Methode angewendet. Es bildete sich keine “Qualle“, sondern eine Haut, die zwar dichter wurde, aber erst absank, als ich das Glas ein bisschen bewegte, damit sie nicht mehr an der Glaswand klebte. Jetzt habe ich da, nach etwa vier Wochen so mehre Häute, die im Glas schweben. Die Flüssigkeit schmeckt wässrig-sauer, aber kein bisschen nach Apfel, obwohl sie nach Apfel riecht. Ich würde das ungern wegwerfen, wenn eigentlich noch schöner essig daraus werden könnte….
1574336080623231425023
Hallo Bee-do,
wo wird denn in diesem Beitrag hier die Kahmhefe mit der Essigmutter gleichgesetzt?
Leider ist es immer schwierig, nur per Beschreibung herauszufinden, was Kahmhefe und was eine dünne Essigmutter ist. So, wie du die verschiedenen Schichten beschreibst, die in deinem Glas schwimmen, klingt es für mich aber eher danach, dass sich schon verschiedene, wenn auch dünne, Essigmütter gebildet haben. Solange der Geruch ok ist, würde ich da auch abwarten und nichts wegschütten.
Lieben Gruß
Heike
Ich bin gespannt! Habe jetzt tatsächlich noch einen Minischluck Wein da gehabt und mit Apfelessig ( wo steht, ob der pateurisiert ist? Aber er ist naturtrüb und Bio. ) Wasser aufgegossen und nun darf er auf dem Heizkörper im Bad Platz nehmen 😊